In den Hamas-Israel-Verhandlungen steckt eine unvorstellbare Sprengkraft
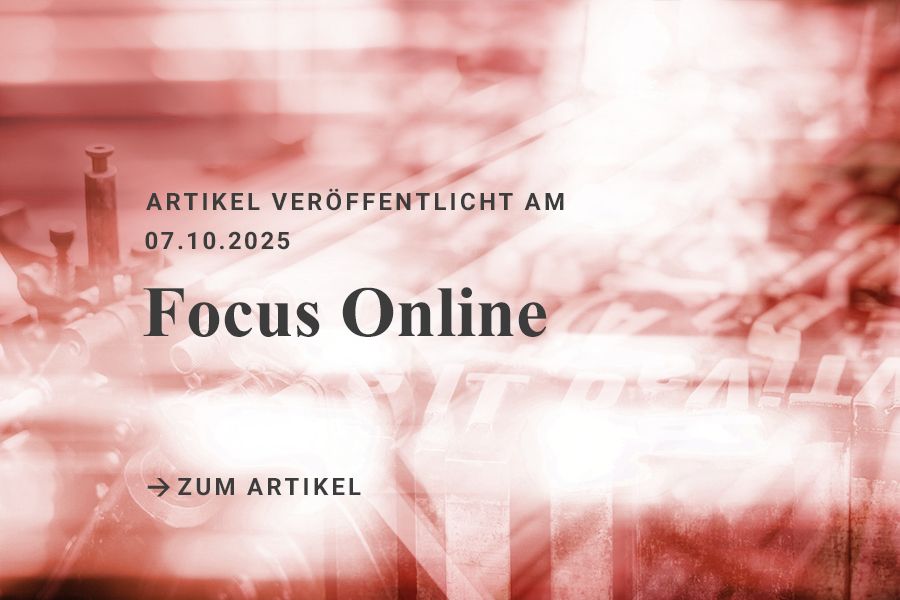
In Ägypten verhandeln Diplomaten und Geheimdienste – über Geiseln, Macht und die fragile Hoffnung auf Frieden. Verhandlungsexperte Thorsten Hofmann erklärt, was die Gespräche so kompliziert macht.
Die laufenden Gespräche zwischen Israel und der Hamas in Ägypten gehören aktuell wahrscheinlich zu den komplexesten und kompliziertesten Verhandlungen der Welt. Unter Vermittlung der USA, Ägyptens und Katars geht es nicht „nur“ um die Freilassung der verbliebenen Geiseln. Es geht um Macht, Kontrolle – und darum, wer am Ende die Deutungshoheit über das Geschehen im Gazastreifen behält.
Das fragile Fenster der Kommunikation
Nach israelischen und ägyptischen Quellen ist derzeit eine israelische Delegation in Scharm el Scheich, um den von Washington vorgelegten Friedensplan zu verhandeln. Parallel sitzt eine Hamas-Delegation unter der Leitung des Auslandschefs Chalil al-Haja in Kairo. Ziel der ersten Phase: Freilassung der Geiseln im Gegenzug für eine temporäre Waffenruhe und die Entlassung palästinensischer Gefangener.
Die Verhandlungen laufen indirekt über sogenannte Back-Channels, also über inoffizielle Kommunikationskanäle. Keine Seite spricht direkt mit der anderen. Zwischen den Fronten vermitteln ägyptische Geheimdienstoffiziere, Akteure aus Katar, US-Sondergesandte wie Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Schon diese Struktur zeigt, wie sensibel die Lage ist: Vertrauen existiert nicht, jede Botschaft wird übersetzt, geprüft, interpretiert. In einer Verhandlung über Menschenleben ist jedes Wort eine Botschaft. Der Tonfall, die Reihenfolge der Themen, selbst die Wahl des Vermittlers sendet Signale über Macht und Kontrolle.
Was tatsächlich auf dem Tisch liegt
Für die Hamas bedeutet eine Freilassung ohne Gegenleistung Schwäche. Deshalb koppelt sie jede Bewegung an politische oder symbolische Bedingungen um das Bild ihrer Stärke, auch in der Zukunft, zu dokumentieren. Israel dagegen muss vermeiden, den Eindruck zu erwecken, sich erpressen zu lassen, und gleichzeitig den Druck der Familien der Entführten aushalten. In solchen Situationen wird nicht allein über die Freilassung selbst gesprochen. Eine Verhandlung über die Freilassung von Geiseln besteht aus mindestens acht zentralen Themenfeldern, die meist parallel verhandelt werden:
- Status der Geiseln: Es muss verifiziert werden, wer in der Gewalt der Entführer ist, ob sie leben, wo sie festgehalten werden und in wessen Händen sie sich befinden. Bei Gruppen wie der Hamas kann dies schwierig sein, weil Geiseln oft auf mehrere Fraktionen verteilt sind.
- Beweise des Lebens: Fotos, Videos oder persönliche Merkmale sind notwendig, um die Echtheit der Geiseln und ihre aktuelle Situation zu bestätigen. Diese Beweise werden taktisch eingesetzt – jede Verzögerung ist ein Druckmittel.
- Grundsätzliche Austauschmodalitäten: Der Kernpunkt: Welche Häftlinge werden im Gegenzug freigelassen? Werden sie ins Ausland abgeschoben oder bleiben in der Region? Wird der Austausch in Etappen oder „all at once“ vollzogen? Neben dem Austausch wird oft über Hilfslieferungen, medizinische Evakuierungen oder Strom- und Wasserversorgung verhandelt. Diese Maßnahmen dienen nicht nur der Humanität, sondern auch als psychologische Hebel. Jede dieser Fragen ist politisch und emotional hoch aufgeladen.
- Modalitäten der Übergabe: Sowohl die Entführer als auch die Gegenseite verlangen Garantien, dass die Übergabe nicht als Falle genutzt wird. Es geht um Schusswaffenfreiheit, neutrale Orte, Luftüberwachung, medizinische Versorgung und Evakuierungsrouten. Wo, wann und unter welchen Sicherheitsgarantien findet die Freilassung statt? Wer kontrolliert die Route, wer überprüft, ob keine militärische Aktion gleichzeitig erfolgt? Hier sind unabhängige Organisationen, den beide Seiten vertrauen, entscheidend.
- Kommunikationskanäle: Wie laufen Nachrichten zwischen den Parteien? Über welche Mittelsmänner, über welche technischen Wege (z. B. sichere Funkkanäle, verschlüsselte Nachrichtensysteme)? Der Verlust eines Kanals kann eine gesamte Verhandlung und später den gesamten Austausch zum Scheitern bringen.
- Gesichtswahrung und Narrative: Jede Seite braucht eine symbolische Legitimation. Die Hamas will zeigen, dass sie Israel „zum Handeln gezwungen“ hat. Israel wiederum muss demonstrieren, dass es die Kontrolle behält und seine Bürger schützt. Diese Erzählungen sind wesentlicher Faktor bei der Einordnung über den Verhandlungserfolg.
- Kontrollmechanismen: Nach der Freilassung folgt meist eine Phase der „Silent Diplomacy“ – in der überprüft wird, ob sich beide Seiten an Zusagen halten und gehalten haben. Das ist entscheidend, um weitere Verhandlungsgegenstände oder längerfristige Waffenruhen vorzubereiten.
- Politische Anschlussfragen: Was passiert nach der Freilassung? Wird die Hamas entwaffnet, zieht Israel Truppen zurück, wie werden humanitäre Zonen kontrolliert? Diese Themen gehören offiziell „nicht zur Geiselverhandlung“, bestimmen aber deren Dynamik maßgeblich.
Back-Channels: Die unsichtbaren Akteure
Hinter der sichtbaren Bühne agieren zahlreiche Nachrichtendienste. Die politische Führung der Hamas operiert in Katar, von wo aus auch finanzielle Unterstützung fließt. Gleichzeitig versucht Katar, Teil der Weltwirtschaft zu sein: Es gibt dort einen US-Militärstützpunkt, Katar investiert an der Wall Street und im Silicon Valley, Qatar Airlines fliegt Ziele in aller Welt an. Katar ist somit ein von beiden Seiten akzeptierter Vermittler.
Die Qassam-Brigaden, der militärischer Arm der Hamas, wird dagegen vom Iran und der Hisbollah im Libanon beeinflusst. Der Iran liefert Waffen, Geld und Technologie für den Raketenbau, die Hisbollah bietet logistische Beratung.
Der ägyptische Geheimdienst GIS hat ebenfalls Kontakte und Einfluss auf den militärischen Arm und vermittelt in den Gesprächen, überprüft Sicherheitsgarantien und organisiert Übergabepunkte an der Grenze von Rafah. Nachrichten, Zugeständnisse, Forderungen und Gegenvorschläge werden oft über GIS-offizielle oder über GIS-vermittelte Kanäle übermittelt. Zusätzlich gewährleistet der GIS Schutz und Diskretion für Delegationen und Verhandlungspartner, etwa bei Reisen von Hamas-Funktionären nach Ägypten. Ohne Ägyptens Rolle als Pufferstaat zwischen Israel, den USA und der Hamas wäre eine Kommunikationslinie kaum denkbar.
Die Türkei ist ebenfalls ein handlungsaktiver Akteur am Tisch. Hunderte von Hamas-Familien leben in der Türkei. Die naheliegendste und einfachste Art, Druck auf die Hamas auszuüben, wäre die Androhung von Ausweisungen. Die Frage ist allerdings: Unter welchen Bedingungen wäre die Türkei dazu bereit?
Warum diese Verhandlungen so schwierig sind
Das größte Problem ist die Asymmetrie. Israel handelt als Staat mit klaren Entscheidungsstrukturen, die Hamas hingegen als fragmentiertes Netzwerk. Der politische Arm in Doha oder Beirut kann verhandeln – aber die Kommandeure in Gaza, die die Geiseln physisch kontrollieren, agieren häufig unabhängig. Manche Geiseln befinden sich gar nicht in Hamas-Gewahrsam, sondern bei Splittergruppen oder Clans, die im Chaos des Krieges eigene Forderungen stellen.
Zudem ist die Kommunikation durch Misstrauen geprägt. Jede Seite geht davon aus, dass die andere taktisch täuscht. Zeit wird als Waffe genutzt: Verzögerungen, Pausen, scheinbare Zugeständnisse dienen dazu, Informationen zu testen oder internationale Reaktionen zu beobachten.
Der amerikanische Faktor
Die USA drängen auf Tempo. Präsident Trump erklärte öffentlich, die „erste Phase müsse diese Woche abgeschlossen werden“. Außenminister Marco Rubio betonte in NBCs „Meet the Press“, dass die Geiselfreilassung Vorrang habe, ein langfristiger Frieden aber nur mit einer Entwaffnung der Hamas möglich sei.
Washingtons Strategie ist zweigleisig: kurzfristig humanitäre Entlastung, langfristig eine Neuordnung des Gazastreifens unter einer technokratischen Verwaltung – ohne Hamas. Doch genau darin liegt die Sprengkraft. Für die Hamas ist jede Entwaffnung gleichbedeutend mit politischem Tod. Deshalb versucht sie, über symbolische Zugeständnisse, etwa die Freilassung einzelner Geiseln, internationale Anerkennung zu erhalten, ohne ihre Waffen abzugeben.
Was jetzt entscheidend ist
In dieser Phase entscheidet sich, ob das fragile Kommunikationsfenster offen bleibt.
Erfahrene Verhandler in solchen Krisensituationen konzentrieren sich auf das Kontrollierbare:
– den Schutz der Kanäle,
– die Stabilität der Übergabepunkte,
– das schrittweise Testen der Zuverlässigkeit der Gegenseite.
Gruppen wie die Hamas können zu weiteren Zugeständnissen bewegt werden, wenn man ihnen eine kontrollierte Form der Anerkennung bietet – also Gesprächsformate, in denen sie ihr Gesicht wahren, ohne politische Legitimität zu erhalten. Das ist kein moralisches Entgegenkommen, sondern psychologische Strategie.
Zwischen Taktik und Tragödie
In den unterirdischen Tunneln von Gaza entscheidet sich, ob Worte stärker sind als Waffen. Die aktuellen Verhandlungen sind kein klassischer Friedensprozess, sondern eine Krisenverhandlung unter Extrembedingungen. Die laufenden Verhandlungen sind ein Mikrokosmos internationaler Machtpolitik. Sie können zeigen, dass belastbare Netzwerke, psychologisches Austarieren und strategische Kommunikation oft mehr bewirken als reines militärisches Vorgehen. Doch sie erfordern Geduld, Disziplin und die Fähigkeit, selbst im Dunkel einen Hoffnungsschimmer zu verhandeln.
Den vollständigen Artikel, der im Focus Online am 07.10.2025 erschienen ist, finden Sie hier.